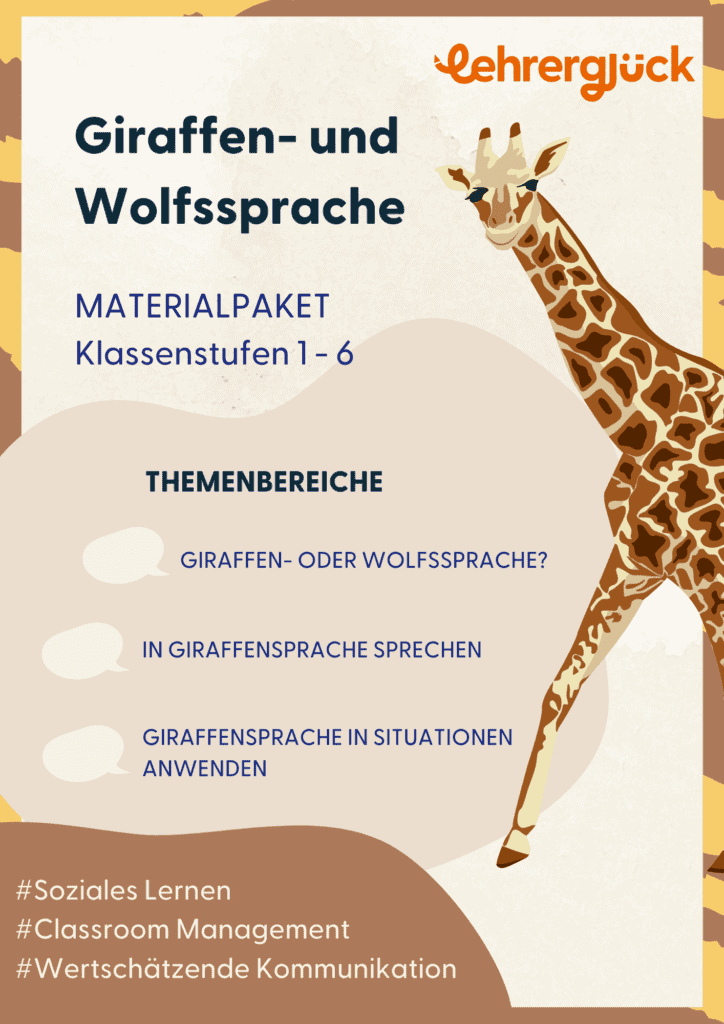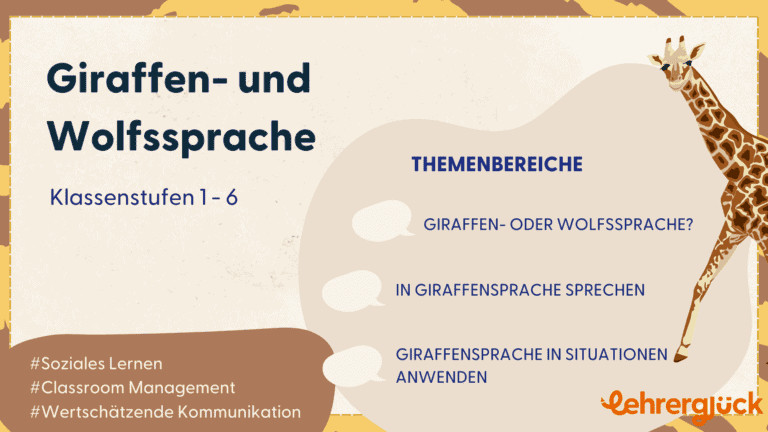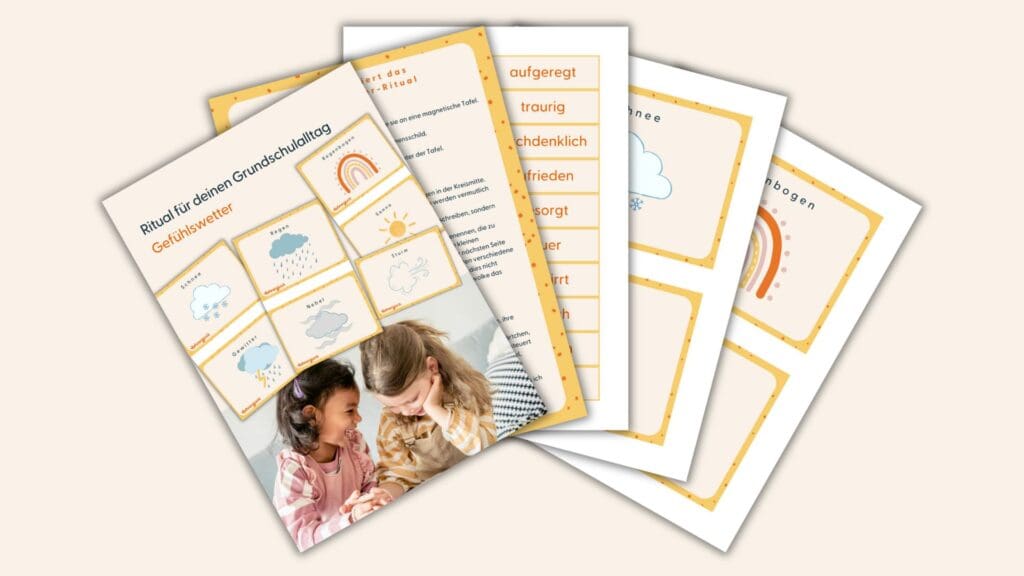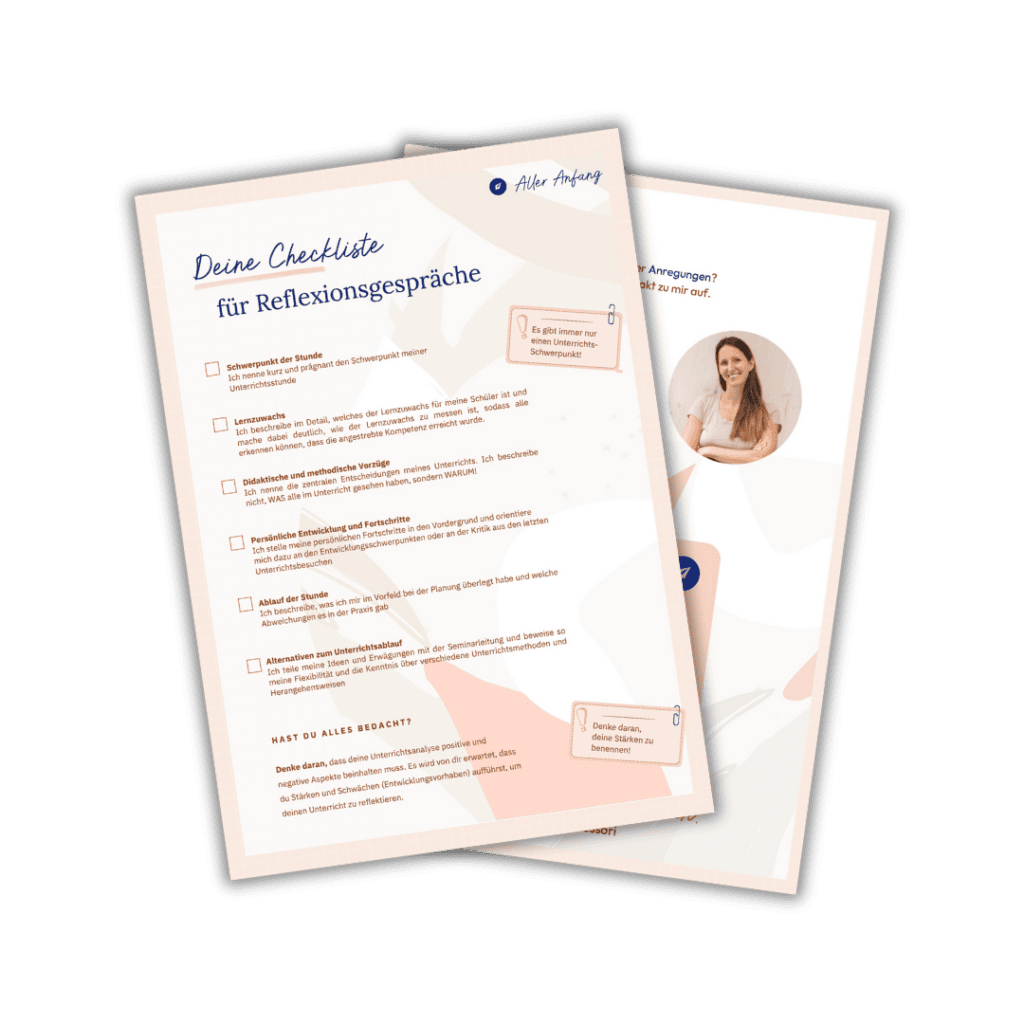Klassenleitung Grundschule: Wie du eine starke Klassengemeinschaft aufbaust und dabei entspannt bleibst
Was dich erwartet
Keine Lust zu Lesen?
Dann schau dir diesen Blog-Beitrag auf YouTube an!
Einleitung
Die Klassenleitung in der Grundschule ist weit mehr als nur Organisationsarbeit und Unterrichtsdurchführung. Sie ist das Herzstück einer funktionierenden Lerngemeinschaft, in der sich jedes Kind gesehen, wertgeschätzt und sicher fühlt.
Ich bin seit über 10 Jahren Klassenlehrerin und habe am Anfang vieles einfach „irgendwie“ gemacht oder mir von Kollegen abgeschaut, was ich gut fand. Über die Jahre habe ich immer wieder Neues ausprobiert, verändert und verbessert. Heute weiß ich: Es gibt kein Patentrezept, aber es gibt Grundprinzipien, die den Unterschied machen.
In diesem Artikel teile ich mit dir meine bewährten Strategien und Erfahrungen, wie du als Klassenleitung eine starke Gemeinschaft aufbaust, ohne dabei deine eigene Gesundheit aus den Augen zu verlieren.
Den Grundstein legen: Wie aus Einzelnen eine Klasse wird
Die ersten Wochen prägen das ganze Schuljahr! Ich investiere bewusst viel Zeit in das Kennenlernen und das Etablieren unserer Klassengemeinschaft. Aber nicht nur die ersten Wochen sind wichtig – auch jede einzelne Woche des Schuljahres nutze ich für den kontinuierlichen Aufbau der Klassengemeinschaft. Ich achte darauf, dass wir nicht nur gemeinsam lernen, sondern auch gemeinsam spielen, lachen, kochen und Erfahrungen teilen.

Ich unterstütze die Kinder dabei, sich wirklich kennenzulernen – das passiert beim gemeinsamen Philosophieren genauso wie beim Hütten bauen im Wald oder beim Wandern. Diese vielfältigen gemeinsamen Erlebnisse schaffen Verbindungen, die weit über das Klassenzimmer hinausgehen und unsere Gemeinschaft stärken.
Zu Beginn des Schuljahres mache ich mir immer viele Gedanken über den Klassenraum. Jedes Jahr sortiere ich wieder neu aus, räume um und verändere Dinge, die mir im letzten Schuljahr aufgefallen sind. Wichtig ist mir aber auch, dass die Kinder bei der Raumgestaltung mitentscheiden – schließlich ist es ihr Klassenraum, und sie haben oft kreative Ideen, die den Raum noch gemütlicher machen.
Das Herzstück ist ein großer Teppich, der als flexibler Treffpunkt dient – für den Sitzkreis, Kleingruppen oder Kinder, die lieber auf dem Boden arbeiten. Eine Leseecke mit Büchern vom Flohmarkt lädt zum Lesen ein, während der Freiarbeitsbereich mit Spielen, Puzzles und Knobel-Materialien selbständiges Lernen ermöglicht. Mein Grundsatz dabei: Im Klassenraum ist nur das sichtbar, was wir regelmäßig brauchen – alles andere verschwindet in Schränken. So bleibt der Raum übersichtlich und die Kinder können sich auf das Wesentliche konzentrieren, während alle wichtigen Materialien für sie gut zugänglich bleiben.
Soziales Miteinander: Das Herz der Klassengemeinschaft
Soziales Lernen ist als Begriff mittlerweile in jeder Schule angekommen, aber was bedeutet er eigentlich? Ist es als Schulfach gemeint? Als Philosophie? An vielen Schulen gibt es eine Stunde pro Woche, die dem Sozialen Lernen gewidmet ist. Ich finde, das reicht längst nicht aus und für mich ist es auch seltsam, diesen so wichtigen Teil unseres Lernens und Zusammenseins von allen anderen Bereichen zu trennen. Denn wenn so viele Menschen täglich auf engem Raum zusammenkommen, ist doch jede Minute jedes Tages „soziales Lernen“ angesagt. Das wertschätzende Miteinander und die Beachtung der Gefühle jedes einzelnen Kindes sind ein zentraler Bestandteil meiner Klassenführung – und meiner Ansicht nach sogar wichtiger als das fachliche Lernen selbst.
Wenn die Hofpause vorbei ist, setzen wir uns zu einem gemeinsamen Frühstück zusammen. Diese Zeit nutze ich bewusst dafür, den Kindern Gelegenheit zu geben, ihre Erlebnisse zu besprechen. Es geht um Streits, um das Gefühl ausgeschlossen zu sein, aber auch um Fairness, Hilfsbereitschaft und Freundschaft. Diese Zeit ist so wertvoll, und ich gebe den Kindern so viel Zeit, wie sie brauchen.
Ich nutze solche Gelegenheiten auch dafür, den Kindern zu verdeutlichen, welche Macht Sprache hat, im Positiven und Negativen. Kleine Wörter, wie „Danke“, ein Kompliment oder eine Ermutigung lassen uns zusammenwachsen, stärken unsere Beziehung. Andere Aussagen dagegen, die den Kindern im Streit herausrutschen, die im Nachhinein „gar nicht so gemeint“ waren, können verletzen und schaden unserem Miteinander. In diesem Zusammenhang fällt auch häufig der Satz „Es ist kein Spaß, wenn dein Gegenüber nicht lacht.“ Ich möchte damit ausdrücken, dass auch gemeine Dinge, die vielleicht „aus Spaß“ gesagt werden, verletzend und gemein sein können und wir damit besser ganz vorsichtig umgehen sollten.
Ein wertvolles Werkzeug ist die Giraffen- und Wolfssprache. Sie ist mein täglicher Begleiter durch den Schulalltag. Die Giraffensprache verkörpert eine wertschätzende, gefühlvolle Sprache, während die Wolfssprache von Ärger und Frust gekennzeichnet ist und anderen Menschen Schmerzen verursachen kann. Mehr zur Giraffen- und Wolfssprache erfährst du in meinem ausführlichen Blog-Beitrag.
Willst du die Giraffen- und Wolfssprache sinnvoll in deinem Unterricht einsetzen?
Dann mach es dir EINFACH und starte SOFORT mit meinem Unterrichtsmaterial zur Giraffen- und Wolfssprache für die Klassen 1 bis 6. Darin findest du eine Feinplanung mit detailliertem Stundenablauf, Anregungen für passende Unterrichtsmethoden und den Materialeinsatz.
Als Klassenleitung ist es essentiell, dass wir die Bedürfnisse und Gefühle unserer Schüler wahrnehmen und ernst nehmen. Kinder, die sich verstanden und gesehen fühlen, können sich besser auf das Lernen einlassen und entwickeln ein stärkeres Selbstbewusstsein.
Deshalb beginnen wir jeden Tag mit dem Gefühlswetter-Ritual. Wetterkarten, die verschiedene Gefühle repräsentieren, hängen an einer Tafel. Die Kinder nehmen ihre Gefühle wahr und hängen ihre Namensschilder zur passenden Wetterkarte. Im Anschluss sprechen wir darüber – wer möchte, darf seine Gefühle teilen. Diese einfache Methode gibt mir täglich einen wertvollen Einblick in die emotionale Welt der Kinder.
Zum Abschluss der Woche treffe ich mich immer mit meiner Klasse im Sitzkreis zu einem Ritual, das wir “Herz und Blitz” nennen. Es ist keine Wochenreflexion und kein Klassenrat, aber vereint wertvolle Aspekte beider Konzepte. Die Kinder sagen reihum, wofür sie in der Woche dankbar sind (Herzkarte) und was sie gestört oder geärgert hat (Blitzkarte). Mit der Blitzkarte verbinden sie dann einen Wunsch. Hier kannst du dir die Herz- und Blitzkarte kostenlos herunterladen: DOWNLOAD
Ich mag das Ritual, weil zum Wochenabschluss wirklich nichts unausgesprochen bleibt und auch Kinder, die sonst wenig sagen, den Raum und die Zeit bekommen, sich mitzuteilen. Ich mag auch, dass wir mit der Herzkarte eine Art Dankbarkeitsritual kultivieren und die Kinder lernen, den Fokus auf die positiven Dinge zu lenken. Außerdem stärkt es den Zusammenhalt, wenn wir uns gegenseitig danken und die schönen Erlebnisse der Woche wertschätzen. Erfahre mehr zum Ritual Herz und Blitz in meinem Blog-Beitrag “12 bewährte Rituale in der Grundschule“.
Konflikte lösen und Regeln leben
Konflikte gehören zum Schulalltag dazu – und das ist auch gut so! Kinder lernen durch Auseinandersetzungen, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen können. Wenn Kinder zu mir kommen, weil sie Streit haben, gehe ich meistens so vor: Erst höre ich den Kindern aufmerksam zu – jedes Kind darf seine Sicht schildern, ohne unterbrochen zu werden. Dann benenne ich die Gefühle: „Du warst also wütend, als…“ oder „Du hast dich ausgeschlossen gefühlt…“. Schließlich finden wir gemeinsam Lösungen: „Was könnt ihr das nächste Mal anders machen?“ Oft lösen sich Konflikte schon allein dadurch, dass sich die Kinder verstanden fühlen.
Was Regeln angeht, habe ich aus meiner eigenen Erfahrung heraus festgestellt, dass das ganze Konstrukt „Klassenregeln“ nichts für mich ist. Meistens werden sie zu Beginn erarbeitet und dann hängen die Regelplakate das ganze Schuljahr unbeachtet an der Wand. Außerdem hat jedes Kind verschiedene Auffassungen davon, welche Regeln wirklich wichtig sind. Warum sollte man sich auf wenige Regeln einigen? Viel wichtiger ist die wertschätzende Grundhaltung, die ich bereits beschrieben habe. Wenn diese gelebt wird, sind explizite Regeln oft überflüssig – das respektvolle Miteinander ergibt sich dann wie von selbst.
Wenn dennoch Grenzen überschritten werden, setze ich auf logische Konsequenzen statt starre Belohnungs- und Bestrafungssysteme. Wer den Klassenraum unordentlich hinterlässt, räumt am nächsten Tag gemeinsam mit mir auf. Wer andere beim Arbeiten stört, arbeitet eine Zeit lang an einem ruhigeren Platz. Das Wichtigste dabei: Ich erkläre den Kindern immer, warum eine bestimmte Konsequenz folgt. Es geht nicht um Strafe, sondern ums Lernen – und darum, dass unser Zusammenleben für alle angenehm bleibt.
Lernen gestalten: Offenheit statt Differenzierungsstress
Ich bin kein Fan von Differenzierung, denn meiner Meinung nach musst du nur differenzieren, wenn das Unterrichtsthema, die Aufgabenstellung oder das Material wenig Freiräume zulässt und die Lernenden selbst keine Mittel kennen, sich den Lernprozess selbst zu gestalten.
Versuche stattdessen einfach, deinen Unterricht zu öffnen und lasse durch die entstehenden Freiräume eine natürliche Differenzierung entstehen, ausgehend vom Kind.
Ich habe beispielsweise ein großes Board im Klassenraum, an dem jede Woche, passend zu den Themen der Woche, Inspirationen für freies Arbeiten notiert sind.
“Wie würde das Seerosenbild von Monet in schwarz-weiß aussehen? Probiere aus.”
“Gibt es auch Symmetrie in der Natur?”
Hat ein Kind seine Aufgaben beendet, kann es an der Tafel nachschauen, womit es sich als nächstes beschäftigen möchte. Neben den Freiarbeitsbereichen und der Lese-Ecke ist dies immer eine schöne Inspiration.
Meine Aufgabenstellungen sind offen formuliert, regen eigene Ideen und Forschung an und ich gestalte das Unterrichtsmaterial so, dass es gar keine Differenzierung benötigt. Außerdem sind die Lernenden im Hinblick auf die Wahl des Lernproduktes immer frei.
Für mich ist Inklusion kein Sonderprogramm, sondern die Grundhaltung meiner Unterrichtsgestaltung. Jedes Kind bringt andere Voraussetzungen mit – und das ist eine Bereicherung, keine Herausforderung. Ich spreche mit den Kindern offen über Unterschiede. “Warum braucht Sam manchmal eine Pause?” “Warum schreibt Maya anders als die anderen?” Diese Gespräche nehmen oft Unsicherheit und schaffen Verständnis. Praktisch bedeutet das: flexible Sitzordnung je nach Bedürfnissen, verschiedene Materialien für verschiedene Lerntypen, Ruhezonen und Bewegungsmöglichkeiten und vor allem Transparenz!
Helfersystem
Je offener du deinen Unterricht gestaltest, desto häufiger kommen die Lernenden mit ganz individuellen Fragen. Die Zeiten sind vorbei, in denen die Lehrperson durch die Klasse läuft und schnell hintereinander Verständnisfragen zu vorgegebenen Schulbuchseiten beantwortet. Hier bewährt sich ein gut funktionierendes Helfersystem: Wer Hilfe braucht, schreibt seinen Namen an die Tafel und beschäftigt sich in der Zwischenzeit mit etwas anderem. Kinder, die gerade ihre Aufgabe beendet haben und Lust haben zu helfen, können nun einem Mitschüler zur Seite stehen. So wird jedes Kind sowohl Helfer als auch Hilfesuchender – starke Leser lesen anderen vor, ruhige Kinder helfen lebhaften Kindern beim Organisieren, kreative Kinder inspirieren beim Schreiben von Geschichten.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Du bist als Lehrperson weniger unter Druck und kannst echte, individuelle Hilfestellungen geben. Gleichzeitig wächst die Klassengemeinschaft durch gegenseitige Unterstützung zusammen, weg vom Konkurrenzdenken hin zu einer wertschätzenden Lernatmosphäre. Die Kinder gewinnen an Selbstbewusstsein, übernehmen Verantwortung und erleben, wie gut es sich anfühlt, einen sinnvollen Beitrag zu leisten.
Digitale Medien: Moderne Werkzeuge im Unterricht
Medienbildung ist mehr als das Aufstellen von Regeln und Verboten. Medien sind aus dem Alltag unserer Kinder nicht mehr wegzudenken – jedes Kleinkind weiß mittlerweile, was ein Smartphone ist und wie man es benutzt. Deshalb brauchen wir eine Medienbildung, die unsere Kinder dazu befähigt, selbstständig und reflektiert mit Medien umzugehen.
Auch bei digitalen Medien setze ich auf sinnvolle Integration statt Selbstzweck. Tablets kommen zum Einsatz für Recherchen, zur Dokumentation von Lernergebnissen oder als Präsentationshilfe. Gleichzeitig nutze ich jede Gelegenheit, um mit den Kindern über den bewussten Medienumgang zu sprechen: Was sind vertrauenswürdige Quellen? Wie lange ist die Bildschirmzeit gesund?
Meiner Meinung nach gelingt Medienbildung nur mit Kindern gemeinsam. Wir müssen die Schule für digitale Medien öffnen, eigene Unsicherheiten überwinden und mit den Kindern gemeinsam an neuen Herausforderungen wachsen. Warum wird an vielen Schulen der Gebrauch von Smartphones verboten, anstatt mit den Kindern aktiv daran zu arbeiten, wie sie ihre Geräte sinnvoll und reflektiert einsetzen können?
Ich beginne mit einem Tablet-Führerschein ab Klasse 2, bei dem die Kinder die grundsätzlichen Funktionen lernen, die sie im Unterricht brauchen: Videos aufnehmen, Notizen machen, Suchmaschinen benutzen, QR-Codes scannen und Fotos für eigene Filme verwenden. Das Ziel ist, dass die Kinder das Tablet selbständig bedienen können, damit im Fachunterricht der Fokus auf dem Unterrichtsgegenstand liegt und nicht auf der Bedienung des Gerätes.
Möchtest du auch Medienbildung in deinem Unterricht umsetzen?
Dann schaue dir mein passendes Unterrichtsmaterial für die Klassen 1 bis 6 an. Dort findest du alles, was du für das Erlernen eines bewussten Medien-Umgangs deiner Schüler brauchst.
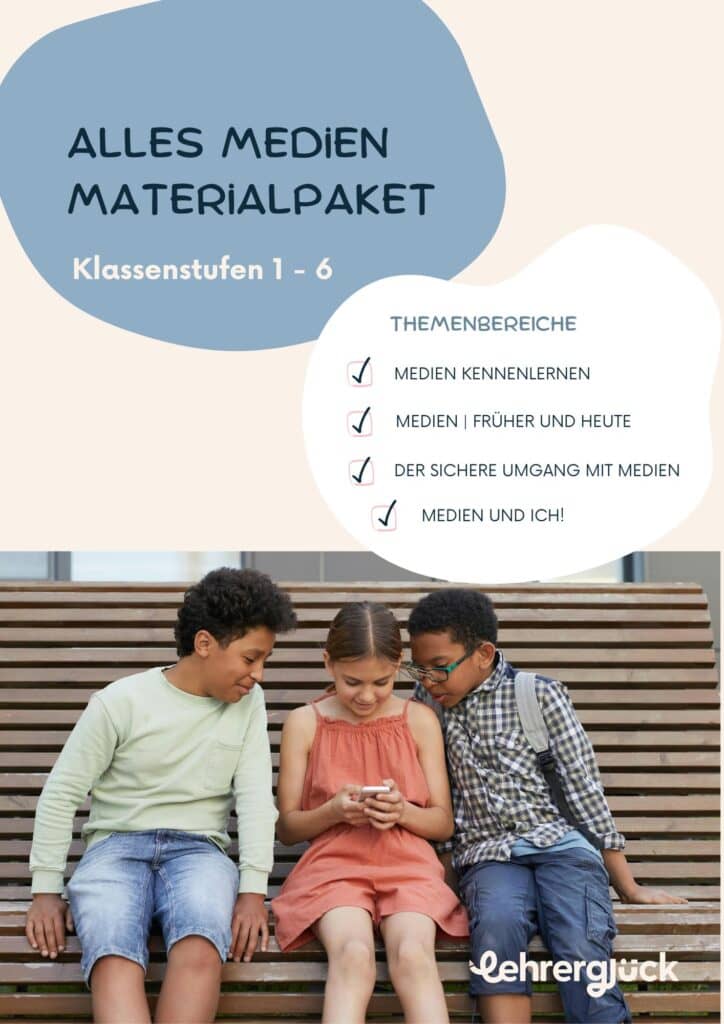
Elternarbeit: Transparenz und Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein Grundpfeiler erfolgreicher Klassenführung. Die Eltern unterstützen mich, wenn es um Anschaffungen für die Klasse geht – Post-Its, Briefumschläge, eine Tube Deckweiß oder Ähnliches. Ich nehme gerne ein oder zwei Elternteile zu Ausflügen mit oder lade mir zusätzliche Unterstützung für einen Projekttag ein. Ich nutze die Kontakte von Eltern, wenn es um die Planung oder Organisation eines Besuches zu einem besonderen Lernort geht, und bringe ihre Expertise in Projekten oder Unterrichtsthemen ein.

In der Zeit der Schulschließungen während Corona habe ich viel über Elternarbeit gelernt: Plötzlich waren mein ganzes Lehrerhandeln und mein Unterricht transparent. Genauso lernte ich die Familien richtig kennen, bekam einen Einblick in ihre Herausforderungen und ihren Alltag. Seitdem mache ich meinen Unterricht noch transparenter und scheue mich nicht mehr davor, die Eltern um ihren Einsatz und um Unterstützung zu bitten.
Eine wichtige Erkenntnis: Ich kann jede Idee umsetzen, wenn ich die Eltern auf meiner Seite habe. Wichtig für die Eltern ist, dass sie die Gewissheit haben, dass ich weiß, was ich tue und kompetent handle. Außerdem hole ich sie frühzeitig mit ins Boot und informiere sie.
Elternabende: Gemeinsam organisiert
Ich mag Elternabende! Ich mag es, mich mit den Eltern auszutauschen, zu teilen, was wir im Unterricht machen und was als nächstes ansteht. Ich gebe den Eltern gerne einen Einblick, wie unser Schultag aussieht, erkläre ihnen die Grundsätze zum Beispiel beim Forschenden Lernen und probiere das Lesen mit der Anlauttabelle mit ihnen aus.
Grundsätzlich (außer beim ersten Elternabend) werden die Elternabende in meiner Klasse von den Elternvertretern organisiert und moderiert. Sie sprechen einen passenden Termin mit mir ab und informieren mich über die von den Eltern gewünschten Tagesordnungspunkte. Dann laden sie die Eltern ein und kümmern sich selbst um Dinge wie Anwesenheitsliste und Protokoll.
Diese Art der Organisation bringt viele Vorteile: Sie spart mir Zeit, reduziert Hierarchien und ermöglicht echte Zusammenarbeit, weil ich als Gast auftreten kann und die organisatorische Verantwortung bei den Eltern liegt. Ich bin wirklich das, was meine Aufgabe ist: Expertin für pädagogische Themen und Lehrerin.
Natürlich bin ich für den Inhalt vieler Tagesordnungspunkte selbst verantwortlich und bereite bei Bedarf auch eine digitale Präsentation vor. Manchmal sind es aber auch Themen der Eltern und ich unterstütze sie nur, wenn nötig. Ich erinnere mich noch daran, dass die Eltern einen Elternabend zum Thema „Medienkonsum im Grundschulalter“ organisiert und selbst einen Experten eingeladen haben. Oder bei Tagesordnungspunkten wie der Planung des Sommerfestes brauchen sie mich eigentlich nicht.
Kontaktmöglichkeiten: Klare Grenzen für deine Work-Life-Balance
Zu Beginn jedes Schuljahres überlege ich mir sorgfältig, wie ich die Elternkommunikation organisiere. Dabei achte ich besonders darauf, dass keine Elternkommunikation auf meinem privaten Handy stattfindet – die Eltern bekommen nicht meine Telefonnummer und ich lasse mir Schul-E-Mails nicht auf mein Handy umleiten.
Für alles, was die Schule betrifft, habe ich eine separate E-Mail-Adresse, die ich über den Browser oder den Schulserver separat abrufen muss. Ich vermeide damit, dass ich beim Öffnen des Laptops oder Handys E-Mails erhalte, mit denen ich mich eigentlich gerade nicht beschäftigen wollte.
Die Eltern haben zwei klare Wege der Kommunikation: E-Mail: Sie haben eine schulische E-Mail-Adresse von mir, deren Nachrichten ich mindestens einmal wöchentlich abrufe. Hausaufgabenheft: Für dringende Mitteilungen und Fragen bitte ich die Eltern um einen Eintrag ins Hausaufgabenheft. In der Spalte Samstag/Sonntag ist meist genug Platz für die Elternkommunikation. Manche Eltern legen auch einen Zettel hinein, den sie mit einer Büroklammer befestigen.

Wie auch immer du die Kommunikation organisierst – es ist wichtig, dass du in erster Linie darauf achtest, wie es für dich am besten funktioniert! Hier geht es um den Schutz deiner eigenen Work-Life-Balance und Privatsphäre. Frage dich nicht, wie es für die Eltern am einfachsten ist.
Elterngespräche
Ich führe Elterngespräche am liebsten vor dem Unterricht – viele Eltern nehmen sogar Termine um 7 Uhr morgens gerne an. Zuerst kam es mir etwas komisch vor, so frühe Termine anzubieten, aber es stellte sich schnell heraus, dass es sogar die beliebteste Zeit ist. Wenn ich weiß, dass Eltern nicht arbeiten oder flexibel von zu Hause arbeiten, biete ich gerne noch meine Freistunden am Vormittag als Option an.
Damit vermeide ich, meinen Nachmittag mit Schul-Terminen zu blockieren. Ich gebe bei der Terminvereinbarung immer eine Anfangs- und Endzeit an. In der Regel reichen 20 Minuten, wenn das Gespräch gut vorbereitet und geführt wird.
Ich bereite meine Elterngespräche immer vor. Die Vorbereitung dauert meist nicht länger als 10 Minuten und ich halte mich dabei an folgende vier Punkte:
Die Notizen dazu mache ich schriftlich und sie sind die Basis für das Gesprächsprotokoll, das ich immer sofort nach dem Gespräch erstelle – auch das dauert nicht länger als 10 Minuten, wenn ich es sofort danach mache.
Natürlich laufen nicht alle Elterngespräche harmonisch ab. Stelle dir vor, ein Elternteil weint beim Gespräch, jemand wird laut und drohend oder du hast das Gefühl, dass man dir nicht zuhört oder vertraut. Dies und vieles mehr kann dir bei Elterngesprächen passieren und ich rate dir immer, das Gespräch auf Augenhöhe und ganz authentisch zu führen.
Bist du betroffen, zeige Betroffenheit.
Ist für dich eine persönliche Grenze erreicht, sage dies und breche das Gespräch gegebenenfalls auch ab. Beim nächsten Mal kannst du eine Kollegin oder einen Kollegen darum bitten, auch dabei zu sein.
Hast du das Gefühl, dass dir nicht vertraut wird, teile diese Beobachtung und sprecht darüber, wie ihr gemeinsam damit umgehen könnt.
Schwierige Phasen der Klassenleitung meistern
Nicht jeder Tag läuft perfekt. Manchmal hast du das Gefühl, dass gar nichts funktioniert. Das gehört dazu und macht dich nicht zu einer schlechten Lehrkraft! Du bist laut geworden und hast jetzt ein schlechtes Gewissen? Du denkst, dass du deine Schüler gerade so überhaupt nicht motivieren kannst? Du versuchst, eine gute Klassenatmosphäre aufzubauen, aber du hast das Gefühl, es gibt mehr Streit als je zuvor?
Meine Strategien für schwierige Phasen sind Gespräche mit meinen Lieblingskollegen für eine frische Perspektive, einen Besuch im sonnigen Café während der Freistunde, kleine Veränderungen im Klassenraum oder bei Ritualen und bei Schwierigkeiten mit einzelnen Kindern das klärende Gespräch.
Ich nehme mir alle paar Wochen bewusst Zeit, um zu reflektieren: Was läuft gerade besonders gut? Wo hake ich immer wieder an den gleichen Stellen? Welche Kinder brauchen momentan besondere Aufmerksamkeit? Wie geht es mir selbst gerade?
Kinder sind übrigens die ehrlichsten Rückmelder – ich hole mir regelmäßig Feedback von meinen Schülern: „Was gefällt euch besonders?“, „Was würdet ihr gern anders machen?“
Lass auch andere Personen in deinen Unterricht oder hospitiere in anderen Klassen! Vielleicht bei einer Kollegin, die so besonderen Wert auf Sprachbildung legt, oder bei einem Kollegen, bei dem alles immer so leicht zu sein scheint. Es ist bereichernd zu sehen, wie andere arbeiten, und du bekommst einen frischen Blick auf deine eigene Praxis.
Suchst du Tipps zum Umgang mit einem konkreten Kind oder zur Durchführung eines Rituals zum Beispiel? Dann lade dir jemanden in deinen Unterricht ein, der dir vielleicht ein paar Ratschläge geben kann. Eine gegenseitige Hospitation und kollegiale Beratung ist immer am effektivsten, wenn ihr euch ganz konkrete Beobachtungsaufträge gebt oder eure Herausforderungen schon im Vorfeld benennt. Dann könnt ihr im Gespräch direkt darauf eingehen und es entsteht kein allgemeines Geschwafel.

Entspannt durch den Schulalltag: Deine Gesundheit geht vor
Ein entspannter Schulalltag beginnt mit einer gesunden Einstellung zur eigenen Arbeitszeit und den eigenen Grenzen. Ich plane jeden Tag nach dem Unterricht eine Stunde für Vor- und Nachbereitung ein. Danach ist wirklich Schluss! Zusammen mit der Stunde vor dem Unterricht ist das mehr als genug Zeit. Damit weiß ich genau, wann ich frei habe, kann Freunde treffen und feste Pläne machen.
Natürlich sitze ich manchmal auch länger, wenn ich ein neues Projekt plane. Dann überlege ich mir aber genau, wann ich dafür Zeit einplane, und schreibe es als festen Termin in meinen Kalender. Ich achte darauf, dass ich intensivere Planungsphasen und die Planung von Projekten nur angehe, wenn ich die nötige Energie und Kreativität habe – also nicht direkt nach dem Unterricht und nicht am Abend. Für mich eignen sich Zeitfenster wie samstags oder sonntags von 7-11 Uhr. Wichtiger Grundsatz: Höre mit der Vorbereitung auf, wenn du merkst, dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst. Manchmal wirkt auch ein kleiner Spaziergang Wunder und du kannst dich danach wieder an den Schreibtisch setzen.
Dein Unterrichtsstil beeinflusst erheblich, wie du den Schulalltag wahrnimmst. Lehrerzentrierter Unterricht erfordert viel aktive Arbeit von dir – du musst den Unterricht in allen Phasen steuern und jedes persönliche Bedürfnis deiner Schüler selbst lösen. Offener Unterricht hingegen bringt für dich viel mehr Ruhe in den Tag, weil deine Schüler ihren Lernprozess selbst steuern. Sie brauchen dich nicht ständig, weil sie sich zum Beispiel über das Helfersystem selbst organisieren oder die Haltestelle im Klassenraum Vergleichen und Austauschen nutzen.
Immer wieder höre ich: „Ich habe es wieder den ganzen Tag nicht geschafft, etwas zu trinken“ oder „Ich war wieder den ganzen Tag nicht auf der Toilette.“ Das darf nicht sein! Du stehst an erster Stelle. Wenn du dich kaputt arbeitest, hat niemand etwas davon. Denke daran, was im Flugzeug immer gesagt wird: Setze erst dir selbst die Sauerstoffmaske auf und hilf dann anderen. Du kannst nicht anderen helfen, wenn du selbst erstickst.
Du hast mehr Freiheiten als du denkst
Das Schulsystem kann überwältigend wirken, aber ich habe gelernt: Wir haben mehr Gestaltungsfreiräume, als wir oft denken! Du denkst, du musst den gesamten vorgegebenen Lernstoff schaffen? Aber hast du nicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass Schüler sowieso vergessen, was wir ihnen im Frontalunterricht beigebracht haben? Wenn sie es sowieso vergessen, musst du dir auch nicht so einen Stress machen! Ich wähle lieber einzelne Themen und Projekte aus, die meine Schüler wirklich durchdringen können. Es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität.
Zeugnisse setzen dich jedes Jahr aufs Neue wieder unter Druck? Auch hier entscheidest du, wie viel Bedeutung du dem Zeugnis verleihst und wie die Bewertung abläuft. Ich bereite die Kinder immer im Vorfeld auf den Zeugnistag vor und betone dabei, wie wenig aussagekräftig Noten über einen Menschen sind. Zur Vorbereitung bemalt jedes Kind seine eigene Din-A4-Versandkiste als Schatzkiste.
Am Zeugnistag lege ich die offiziellen Zeugnisse in verschlossene Umschläge für die Eltern. Die Kinder bekommen von mir einen persönlichen Brief – das „wahre Zeugnis“ – zusammen mit besonderen Lernprodukten, Kunstbildern, dem Lerntagebuch und Sachunterrichtsheft in der selbst gestalteten Schatzkiste. Die Kinder und Eltern lieben es, das Schuljahr mit der Schatzkiste abzuschließen und zu reflektieren. Viele sagen, dass sie zwar kurz auf das offizielle Zeugnis schauen, es aber nach der Schatzkiste eigentlich seine Bedeutung verloren hat.
Und wer hat eigentlich gesagt, wie viel du von den Lehrbüchern nutzen musst? Nur weil sie dir zur Verfügung gestellt werden, heißt das nicht, dass du sie vollständig einsetzen musst! Du entscheidest, welche Seiten du auf welche Weise einbindest, ob du das Buch nur für bestimmte Schüler nutzt und wie du deinen Unterricht gestaltest. Sowohl die Eltern, als auch deine Schulleitung müssen natürlich davon überzeugt sein, dass du weißt, was du tust. Stehe zu deiner professionellen Haltung und vertrete deine Überzeugungen in Bezug auf deinen Unterricht selbstbewusst.
Sogar bei Diktaten hast du Wahlmöglichkeiten: Du entscheidest, wie ihr euch vorbereitet, ob du diktierst oder die Kinder sich gegenseitig, ob alle am gleichen Tag schreiben oder jeder, wenn er sich bereit fühlt, und wie die Rückmeldung aussieht.
Entwickle deine eigene pädagogische Handschrift! Lass dich von anderen inspirieren und experimentiere mit deinem Unterrichtsstil. Finde heraus, was zu dir passt, und entwickle das weiter.
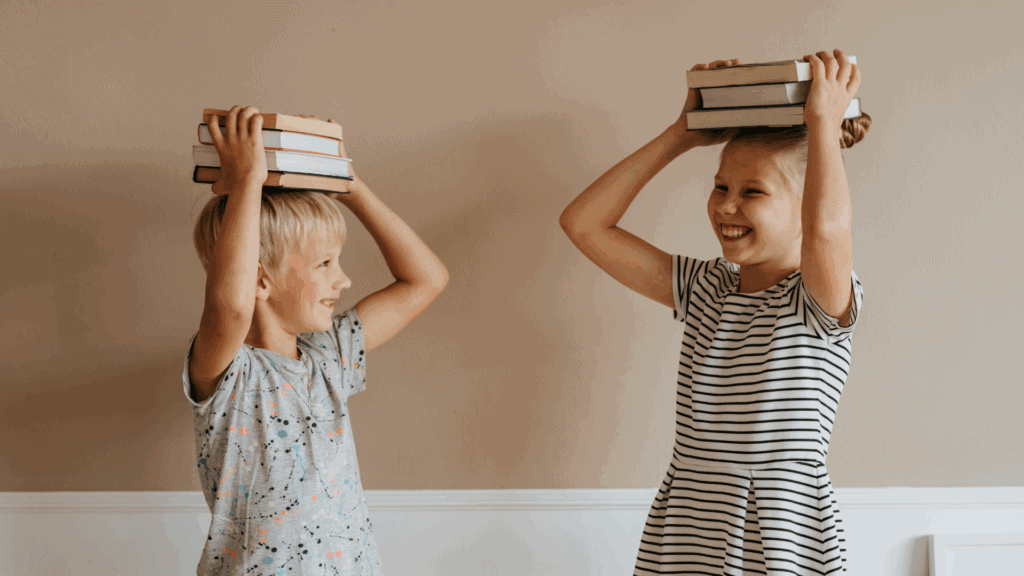
Zum Schluss noch ein Tipp: Führe ein kleines Tagebuch über deine Unterrichtserfahrungen! Schreibe jeden Tag nur zwei, drei Sätze auf. Das können Zitate von Schülern sein, oder eigene Reflexionen: Was war heute schön? Was hat mich überrascht?
Fazit: Du gestaltest das System mit
Ich habe mich dem Schulsystem nie ausgeliefert gefühlt. Ich habe sogar Spaß daran, mir die Lücken im System zu suchen – besonders wenn es den Kindern zugutekommt! Das System ist geschmeidiger, als wir oft denken. Warum? Weil wir das System sind! Jede Lehrkraft kann durch bewusste Entscheidungen und mutiges Handeln das System von innen heraus positiv verändern.
Trau dich, deine Klassenleitung so zu gestalten, dass sie zu dir und deinen Werten passt. Deine Schüler, ihre Eltern und nicht zuletzt du selbst wirst davon profitieren.
Habe ich sonst noch etwas zum Thema vergessen? Dann schreib es mir unten in die Kommentare!
Deine Tatiana
Ähnliche Beiträge
* Affiliate-Disclaimer: Wir sind Mitglied im Partnerprogramm von Amazon. Wenn du etwas über unsere Produktlinks auf Amazon kaufst, erhalten wir eine kleine Provision, die deinen Kaufpreis nicht beeinflusst. Affiliatelinks sind wie folgt gekennzeichet: (Affiliate-Link*)